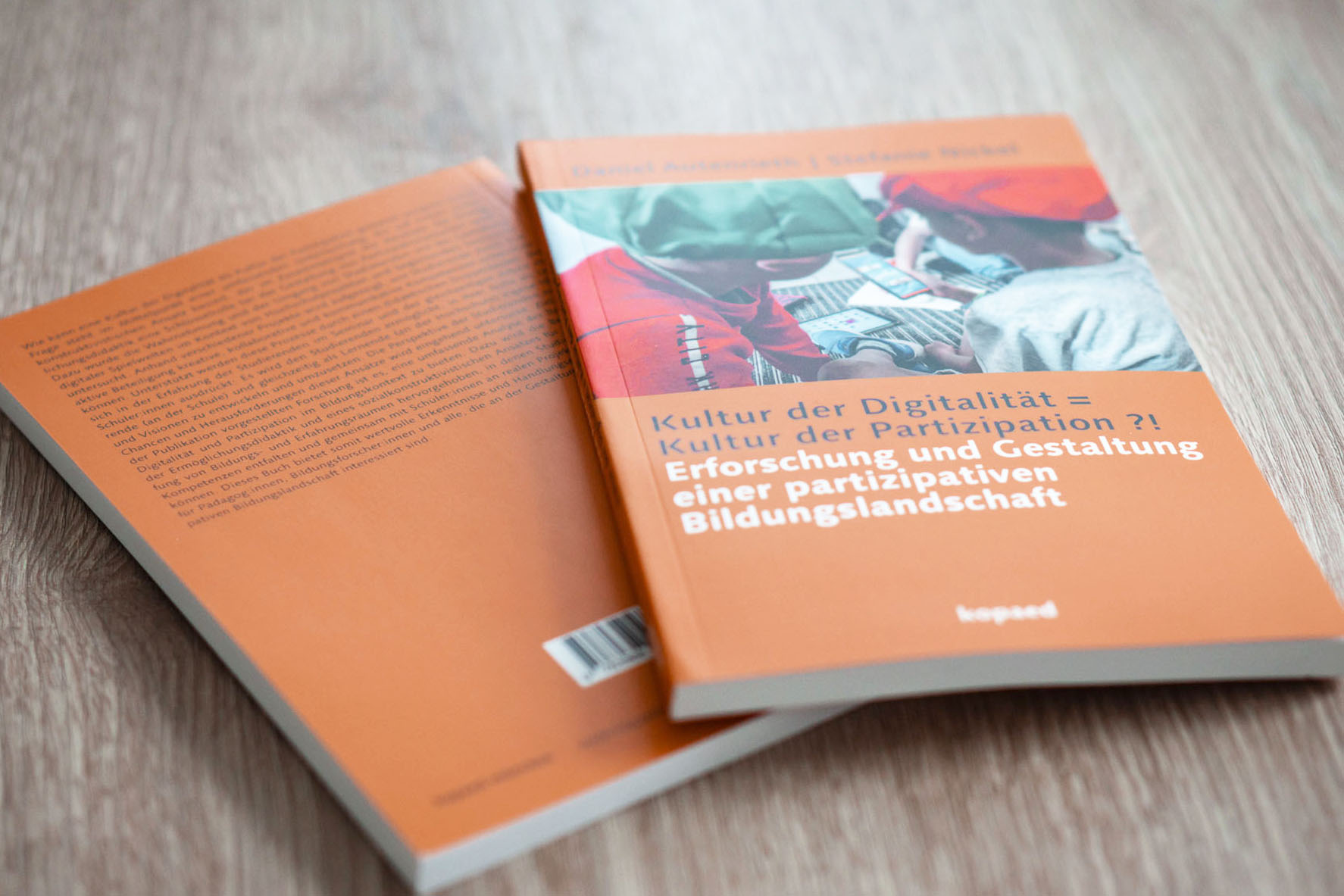Unsere Publikation rückt das Zusammenspiel von Medien-, Demokratie- und Kultureller Bildung in den Fokus. Thematisiert werden u.a. der Einsatz digitaler Techniken in der Schule sowie die partizipativ-interdisziplinäre Entwicklung von Schule und Unterricht im Kontext gesamtgesellschaftlicher Transformationsprozesse. Theoretische Rahmung bilden Annahmen darüber, dass es beim Einsatz von digitalen Medien in der Schule um ein Lernen mit und über Medien geht, damit sich Schüler:innen selbstbestimmt und kritisch-reflexiv in ihren vielfältig geprägten Lebenswelten bewegen, sich selbständig Urteile bilden und ihre kulturell-politische Identität sowie Umwelt eigenständig erschließen können.
In einer digital geprägten Welt (z.B. Brinda u. a. 2020) stehen Bildungsinstitutionen vor der Herausforderung, Lernräume zu schaffen, die nicht nur den Wissenserwerb fördern, sondern auch reale Partizipationsmöglichkeiten bieten (hier => Autenrieth und Nickel 2024). Untersucht wurde, wie Game Design (Browning 2016, McGonigal 2012) und Game-based Learning (Autenrieth und Nickel 2023) Ansätze als Katalysatoren für Beteiligung, Kreativität und Selbstwirksamkeit in Bildungskontexten wirken können (Autenrieth und Nickel 2024).
Die Kultur der Digitalität (Stalder 2019, Stalder 2021) hat nicht nur unsere Kommunikation und Informationsverarbeitung verändert, sondern auch neue Perspektiven für eine partizipative Didaktik (Autenrieth & Nickel 2024, Mayrberger 2020) eröffnet. Besonders im Kontext der Lehrkräftebildung stellt sich die Frage, wie angehende Pädagog:innen auf diese Veränderungen vorbereitet werden können. Dabei geht es nicht nur um technische Kompetenzen, sondern um ein grundlegendes Verständnis für kreative, kollaborative und selbstbestimmte Lernprozesse in post-digitalen Möglichkeitsräumen, die die Subjektivierungsprozesse unterstützen (Jörissen 2017).
Die im vorgestellten Strukturmodelle sind in diesem Zusammenhang das Ergebnis einer dreijährigen Design-based Research Studie zwischen 2021 bis 2024 mit Fokus auf die Frage, wie sich pädagogische Räume mit, über und durch digitale Technologien und KI gestalten lassen. Folgende forschungsleitende Fragen wurden der Untersuchung zugrunde gelegt: Eignen sich Gaming und Game Design dafür, dass Menschen zu kreativem und kommunikativem Handeln angeregt werden? Welche Spiele und Spielformen sind besonders geeignet und warum? Ausgehend von diesen Fragestellungen entwickeln wir Konzepte, die Spielmechaniken mit Partizipationsmöglichkeiten verbinden und so neue Wege des Lehrens und Lernens eröffnen.
Der forschungsmethodische Ansatz basierte auf der iterativen Entwicklung und Erprobung kreativer Bildungsprozesse in realen Kontexten. Über die dialogische Verzahnung von Schule, Hochschule und drittem Ort wurden projektbasierte hybride Bildungs- und Erfahrungsräume mit Fokus auf Game-based Learning entworfen, getestet und angepasst. Der Prozess umfasste mehrere Zyklen, um die theoretische Modellierung bei der praktischen Implementierung innerhalb der Bildungslandschaft zu begleiten und zu analysieren. Grundlage bildete eine interdisziplinär angelegte, sozial-konstruktivistische Perspektive, um kreative Handlungsmöglichkeiten und kollektive Wissensprozesse partizipativ zu gestalten und kritisch zu reflektieren (für eine ausgiebige Darlegung siehe die hier vorgestellte Monografie von Autenrieth und Nickel 2024). Angestrebt wurde, Gestaltungsoptionen offenzulegen unter Rekurs auf Prinzipien wie Mitgestaltung, Mitsprache und Mitbestimmung, während zugleich strukturelle Rahmenbedingungen ausgelotet werden. Betonung findet die Rolle des aktiv handelnden Subjekts sowie die dynamische Wechselbeziehung zwischen dem Subjekt und Strukturen in Anlehnung an Giddens (1988), während Interaktion und Resonanz (vgl. Rosa 2016) eine wichtige Rolle einnehmen, um dialogisch verzahnte Bildungsprozesse zu fördern.